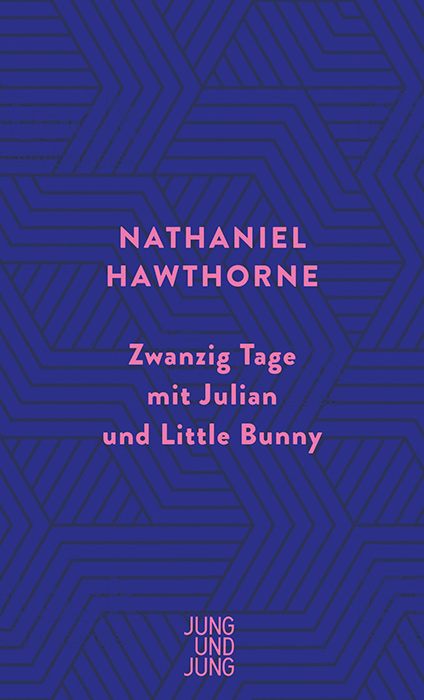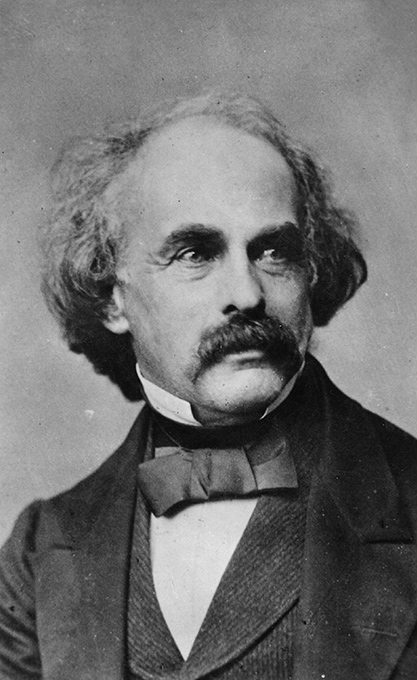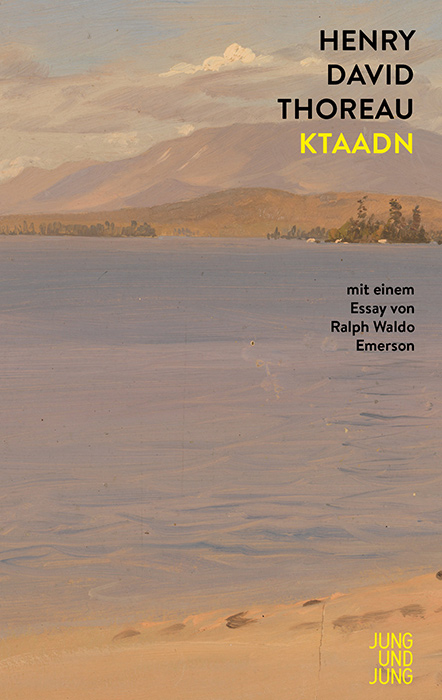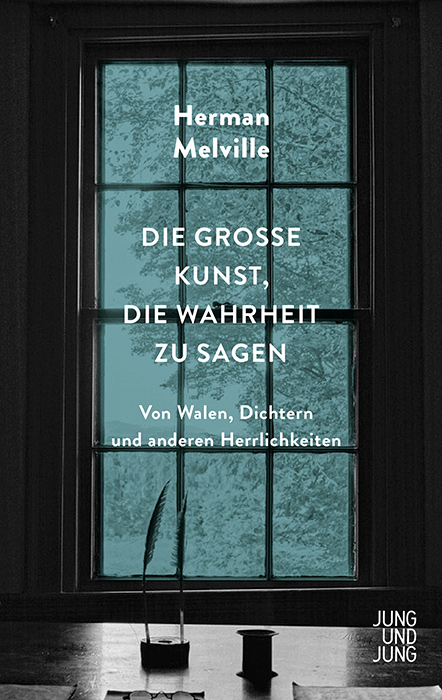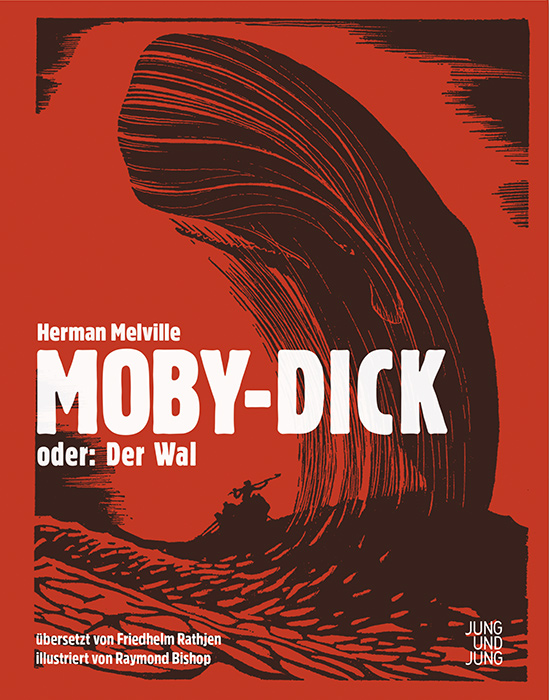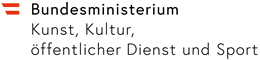Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite obligatorisch und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionen sowie Grundfunktionen zur Seitennavigation und zum Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite. Zusätzlich können wir mit diesen Cookies feststellen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um die Benutzererfahrung bei einem erneuten Besuch unserer Seite für Sie effizienter zu gestalten.
-
Session:
Das Session-Cookie speichert relevante Informationen über Ihre aktuelle Sitzung über eine Reihe von Seitenaufrufen. -
Gerätezuordnung:Die Gerätezuordnung dient dazu für die im Moment aktive Displaygröße die optimale Darstellung zu gewährleisten.
-
CSRF-Token:Eine Cross-Site-Request-Forgery ist ein Angriff auf ein Computersystem. Das CSRF-Token-Cookie trägt zu Ihrer Sicherheit bei. Es verstärkt die Absicherung bei der Nutzung von Formularen gegen unerwünschte Hackangriffe.
-
Login Token:Das Login-Token ist eine sicherheitsbezogene Funktion und dient der sitzungsübergreifenden Erkennung von Anwendern. Das Cookie ermöglicht eine Personalisierung über mehrere Browsersitzungen, beinhaltet aber keine persönlichen Daten.
-
Cookies Aktiv Prüfung:Das Cookie wird verwendet um festzustellen, ob Cookies vom Browser des Seitennutzers zugelassen werden.
-
Cookie Einstellungen:Das Cookie ermöglicht die Speicherung der Cookie-Einstellungen des Seitenanwenders über etliche Browsersitzungen hinweg.
-
Herkunftsinformationen:Das Cookie speichert die Herkunftsseite und die zuerst besuchte Seite des Benutzers für eine weitere Verwendung.
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
- Google Analytics
Google Analytics wird eingesetzt, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Dabei können Statistiken über Webseitenaktivitäten erstellt und ausgelesen werden.
Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!
Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.